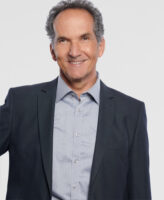Ist ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der regelmäßig mehr als zehn Mitarbeiter im Sinne des KSchG beschäftigt und besteht das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate, kann der Arbeitnehmer gegen eine Arbeitsvertragskündigung Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht erheben. Das Arbeitsgericht überprüft dann die soziale Rechtfertigung der Kündigung, mithin ob den Kündigungsausspruch rechtfertigende betriebs-, personen- oder verhaltensbedingte Kündigungsgründe vorliegen. Gemäß § 4 S. KSchG muss diese Klage innerhalb einer Frist von 3 Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung eingereicht worden sein. Wird die Klage nicht rechtzeitig erhoben und bestehen keine Gründe für eine nachträgliche Klagezulassung, wird die soziale Rechtfertigung der Kündigung unwiderleglich vermutet, die zu spät eingereichte Klage des Arbeitnehmers wird abgewiesen. Der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung kann damit streitentscheidend sein.
Nach herrschender Rechtsprechung ist der Arbeitgeber als Beklagter im Kündigungsschutzprozess für den Zeitpunkt des Kündigungszugangs, der für die Berechnung der Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage maßgeblich ist, beweisbelastet. Die Kündigung als verkörperte Willenserklärung geht dem Arbeitnehmer zu, sobald sie – so die Rechtsprechung – „in verkehrsüblicher Weise in die tatsächliche Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt ist und für diesen unter gewöhnlichen Verhältnissen die Möglichkeit besteht, von ihr Kenntnis zu nehmen“. Grundsätzlich ist es möglich, die schriftliche Arbeitsvertragskündigung auf dem Postweg zu versenden, der Briefkasten des Arbeitnehmers gehört zu dessen Empfangsbereich. Erfolgt der Einwurf in den Briefkasten zu den üblichen Postlaufzeiten, ist der Zugang der Kündigung an diesem Tag wirksam bewirkt.
In der Praxis ist regelmäßig zu beobachten, dass Arbeitgeber die Rechtsansicht vertreten, dass die Zustellung einer Kündigung im Wege des sogenannten Einwurf-Einschreibens eine rechtssichere Möglichkeit darstellt. In der Entscheidung vom 30.01.2025 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt, welche Voraussetzungen bestehen, damit der Arbeitgeber seiner Darlegungs- und Beweislast für den Zeitpunkt der Kündigungszustellung wirksam nachkommt. Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber die Kündigung mit Einwurf-Einschreiben versandt und im Verfahren zum Nachweis des Zugangs den Einlieferungsbeleg des Einwurf-Einschreibens vorgelegt. Aus diesem gingen das Datum und die Uhrzeit der Einlieferung in die Postfiliale und eine Sendungsnummer hervor. Weiter hat der Arbeitgeber den online in der Sendungsverfolgung abgerufenen Sendungsstatus vorgelegt. Darin wurde die Zustellung der Sendung an einem konkreten Datum bestätigt.
Der Arbeitgeber vertrat im Verfahren die Rechtsansicht, dass durch die vorgelegten Unterlagen – den Einlieferungsbeleg mit Sendungsnummer und den online abgerufenen Sendungsstatus, der die Sendungsnummer und ein Zustellungsdatum aufwies – jedenfalls ein Anscheinsbeweis für den Zugang des Kündigungsschreibens zum dokumentierten Datum erbracht worden sei. Dem folgte das BAG nicht. Das BAG führte aus, dass allein durch die Vorlage des Einlieferungsbelegs und des Ausdrucks des Sendungsstatus weder der Einwurf des Kündigungsschreibens in den Briefkasten des Arbeitnehmers nachgewiesen worden ist, noch hierfür ein Anscheinsbeweis besteht. Dies begründet das BAG damit, dass sich auch bei Vorlage des online abgerufenen Sendungsstatus weder feststellen lässt, wer die Sendung zugestellt hat, noch zu welcher Uhrzeit, zu welcher Adresse oder in welchem Zustellbezirk die Zustellung erfolgt ist. Aus Sicht des BAG fehlen im Sendungsstatus also wesentliche Angaben. Damit ist festzustellen, dass durch die Vorlage des Einlieferungsbelegs in Kombination mit dem Sendungsstatus nicht einmal ein Beweis des ersten Anscheins für die Zustellung der Kündigung geführt werden kann. Auch wenn dies nicht zur Entscheidung stand, führt das BAG am Rande weiter aus, dass für den Arbeitgeber die Möglichkeit bestanden hätte, zusätzlich die Reproduktion eines Auslieferungsbelegs anzufordern. Hier liegt das BAG auf einer Linie mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH). Dies hatte der Arbeitgeber im entschiedenen Fall nicht veranlasst.
Die Rechtsprechung des BAG macht deutlich, dass die Zustellung einer Arbeitsvertragskündigung keine bloße Formalie darstellt, sondern die genauen Modalitäten im Kündigungsschutzverfahren streitentscheidend sein können – dies möglicherweise Monate nach Zustellung der Kündigung. Daher darf ernstlich bezweifelt werden, ob die Zustellung einer Arbeitsvertragskündigung per Post das Mittel der Wahl sein sollte oder Alternativen der Vorzug zu geben ist. Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die mit dieser Problematik befasst sind, ist daher anzuraten, sich qualifiziert anwaltlich beraten zu lassen.
Thomas Wöhrle
Fachanwalt für Arbeitsrecht